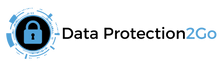Videoüberwachung
Videoüberwachung ist ein wirksames Mittel, um Unternehmensgelände, Mitarbeiter und Kunden zu schützen. Doch dabei gelten strenge Datenschutzvorgaben, die Unternehmen einhalten müssen, um rechtliche Konsequenzen zu vermeiden. Besonders bei der Speicherdauer sind die Datenschutzbehörden sehr kritisch. Dieser Beitrag erklärt, wie Unternehmen Videoüberwachung datenschutzkonform einsetzen können.
1. Rechtliche Grundlagen der Videoüberwachung
Die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und das Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) setzen klare Rahmenbedingungen für den Einsatz von Videoüberwachung. Videoaufnahmen gelten als personenbezogene Daten, wenn Personen identifizierbar sind. Daher müssen Unternehmen sicherstellen, dass ihr Einsatz gerechtfertigt ist.
Zulässigkeit der Videoüberwachung
Die Videoüberwachung darf nur erfolgen, wenn ein berechtigtes Interesse vorliegt (Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO). Solche Interessen können sein:
- Schutz vor Diebstahl oder Vandalismus
- Wahrnehmung des Hausrechts
- Schutz von Mitarbeitern und Kunden
Jedoch ist eine Abwägung mit den Rechten der betroffenen Personen erforderlich. Eine übermäßige oder dauerhafte Überwachung ist unzulässig.
2. Transparenz und Hinweispflichten
Betroffene müssen über die Videoüberwachung informiert werden. Dazu gehören:
- Hinweisschilder an den überwachten Bereichen
- Informationen zur verantwortlichen Stelle (z. B. Name des Unternehmens)
- Zweck der Überwachung
- Rechte der Betroffenen (z. B. Auskunftsrecht, Widerspruchsrecht)
3. Speicherdauer von Videoaufnahmen
Eines der sensibelsten Themen beim Datenschutz ist die Speicherdauer von Videoaufnahmen. Grundsätzlich gilt: Aufnahmen dürfen nicht länger gespeichert werden, als es für den Zweck erforderlich ist.
Maximale Speicherdauer
Die Datenschutzbehörden sind hier besonders streng: In der Regel liegt die maximale Speicherdauer bei maximal 72 Stunden. Eine längere Speicherung ist nur in Ausnahmefällen zulässig, beispielsweise wenn ein sicherheitsrelevantes Ereignis vorliegt und die Aufnahmen zur Aufklärung benötigt werden.
Eine automatische Löschung der Aufnahmen nach Ablauf der zulässigen Frist ist zwingend erforderlich. Unternehmen sollten ein entsprechendes Löschkonzept implementieren und dokumentieren.
4. Zugriffsbeschränkung und Sicherheit
Videoaufnahmen müssen vor unbefugtem Zugriff geschützt werden. Dazu gehören:
- Zugriffsberechtigungen nur für befugte Personen
- Verschlüsselung und sichere Speicherung der Daten
- Protokollierung von Zugriffen
Eine Weitergabe der Aufnahmen an Dritte ist grundsätzlich unzulässig, es sei denn, es gibt eine gesetzliche Grundlage (z. B. Strafverfolgungsbehörden).

5. Datenschutz-Folgenabschätzung
Wenn eine umfangreiche Videoüberwachung geplant ist, muss eine Datenschutz-Folgenabschätzung (DSFA) nach Art. 35 DSGVO durchgeführt werden. Dies ist insbesondere erforderlich, wenn:
- öffentlich zugängliche Bereiche überwacht werden
- eine systematische und umfangreiche Überwachung erfolgt
Die DSFA hilft, Risiken zu bewerten und Schutzmaßnahmen zu ergreifen.
Fazit: Datenschutzgerechte Umsetzung
Um Videoüberwachung datenschutzkonform einzusetzen, sollten Unternehmen folgende Punkte beachten:
- Ein berechtigtes Interesse muss vorliegen
- Betroffene müssen informiert werden
- Die Speicherdauer darf maximal 72 Stunden betragen (Ausnahmen sind zu begründen)
- Technische und organisatorische Maßnahmen zum Schutz der Daten sind notwendig
- Eine Datenschutz-Folgenabschätzung kann erforderlich sein
Unternehmen, die sich an diese Grundsätze halten, minimieren rechtliche Risiken und sorgen für eine transparente und sichere Nutzung von Videoüberwachung. Wer unsicher ist, sollte sich von einem Datenschutzexperten beraten lassen.